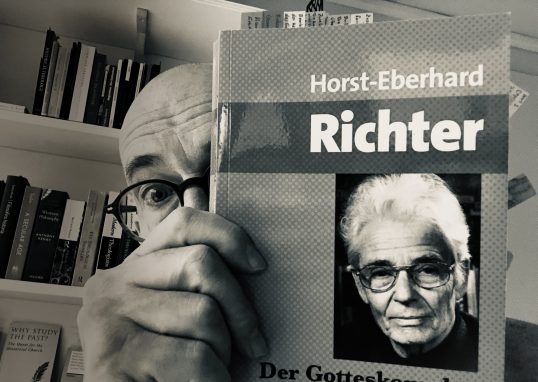Im Rückspiegel sieht vieles ganz anders aus als durch die Windschutzscheibe.
Als wir vor zehn Jahren begannen, unseren Dienst in Göteborg vorzubereiten, kristallisierte sich der Auftrag heraus, neue Ansätze für die Gemeinde der Zukunft zu entwickeln, und zwar durch den Start eines Pilotprojektes. Vor unserer Ausreise sah der Plan im Groben so aus:
a) Möglichst viele Menschen weit außerhalb bestehender Kirchen und Gemeinden kennenlernen und freundschaftliche Beziehungen zu ihnen aufbauen und pflegen
b) Mit Unterstützung vieler Fürbeter möglichst viele kreative Ideen entwickeln und testen, wie das Evangelium dort proklamiert werden kann, wie man Interesse weckt und um dann dazu einzuladen
c) Eine Anzahl x Menschen wird erwartungsgemäß daraufhin Jesus und neues Leben finden und sowohl mit Jesus als auch in Gemeinschaft mit Gleichgesinnten leben wollen (x war nicht definiert, doch lag wahrscheinlich gefühlt irgendwo zwischen 30 und 100)
d) Gemeinsam mit den Leuten aus der Menge x entwickeln wir Ideen und Ansätze, wie Jüngerschaft in unserer Zeit gelehrt und eingeübt werden kann
e) Nach erreichter Selbstständigkeit wird der gesamte Prozess ausgewertet und daraufhin neue und ähnliche, aber angepasste Projekte in nah und fern gestartet und zu einem mehr oder weniger losen Netzwerk verknüpft
f) Die Summe aller Erfahrungen wird allen Gemeinden als eine Ressource für Missions- und Gemeindegründungsarbeit zur Verfügung gestellt.
So weit, so gut.
Punkt a) und b) hat unsere Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern übertroffen.
Punkt c) wurde hingegen zum Hornberger Schießen: unsere “gefühlten” Erwartungen an x waren maßlos übertrieben. Nur extrem wenige haben es geschafft.
Mit c) als schwächstem Glied der Kette kam es nie zu d) – f), jedenfalls nicht, wie erwartet. Stattdessen wurde a) und b) wiederholt und schließlich H2O vom eigenen Team und damit vor allem von langjährigen, wenn auch sehr missionarischen Christen geformt, aber kaum unter Einbeziehung Neubekehrter.
Diese Geschichte ist nach wie vor eine Fallstudie aus der es viel zu lernen gibt. Im Laufe der Zeit habe ich auf new-reformation eine Menge Blogposts geschrieben, die das Erlebte vorstellen, dokumentieren, reflektieren und bearbeiten. Viel gehört jetzt ausgewertet, denn erst im Rückblick ergeben manche Dinge Sinn, viel mehr, als zunächst klar war. Muster werden erkennbar. Eines davon möchte ich heute erwähnen.
Obwohl wir uns als bewusst “missionales” Projekt klar von erfolgreichen “attraktionalen” Megagemeinden wie z.B. CA’s Crossroads-Gemeinden distanziert haben, sind wir unterbewusst mit derselben Grundannahme wie z.B. Willow-Creek ans Werk gegangen: Der Wunsch nach “relevanter” Gemeinde. Was uns von Mega- und weniger Megagemeinden unterschied, war der Wunsch, weniger Programm im Gemeindehaus und dafür mehr Beziehung auf Grund und Boden des Missionsfelds zu haben. Obwohl das an sich sehr gut ist und dringend benötigt wird, so ist der Kern der Sache doch derselbe: Wenn Form und Inhalt stimmen, dann wächst auch die Gemeinde. Im Grunde wollten wir mit Hilfe der potentiellen Ernte auf dem Missionsfeld noch bessere Form und noch relevantere Inhalte finden. Auch dies ist sehr gut und wird, wenn gut gemacht, dringender gebraucht denn je. Problematisch wird allerdings die Schlussfolgerung “… dann wächst auch die Gemeinde.”
Hier haben wir eine Hypothese, die mir im Laufe der Jahre immer und immer und immer wieder und noch einmal begegnet ist. Man findet sie
Gemeinden, in Literatur, auf Konferenzen, in theologischen Ausbildungen und ganz besonders in Gemeindeentwicklungs- und -gründungskursen. Selten ist sie klar und deutlich formuliert. Meist findet man sie zwischen den Zeilen in Form von Geschichten. Doch die meisten Gemeindeleiter, Missionskommitees und so weiter werden unterbewusst davon gesteuert.
Das Problem wird deutlich, wenn man es umgekehrt ausdrückt: Wächst die Gemeinde nicht, dann stimmen Form und/oder Inhalt nicht. An genau dieser Hypothese sehe ich eine wachsende Anzahl Leiter, Missionare oder Pastoren verzweifeln. Sie sehen nicht das gewünschte Wachstum, damit stellen sie logischerweise ihren Dienst, ihr Leben, sogar ihren Glauben in Frage. Manche geben auf, immer mehr landen im Burnout, viele leben in heimlicher Scham. Wenn Gemeindewachstum allein von Form und Inhalt abhängig ist, hängt nämlich der Wert des Leiters vom messbaren Erfolg ab.
Diese Annahme muss ich massiv in Frage stellen. Es handelt sich hier um eine Missionsvariante des sogenannten Wohlstandsevangelium: Wer alles richtig macht, erhält den Segen Gottes. Für Privatpersonen kann der Segen die Form von Rolexuhren oder Mercedessternen haben. Für Pastoren sind es große Gemeinden oder beachtete Bewegungen. Wer nichts macht, bekommt auch keinen Segen und damit weder Luxus noch Gemeindeeinfluss. Wer alles falsch macht, bekommt Minussegen, auch als Fluch bekannt. Vielleicht ein schwerer Unfall oder eine Krankheit.
Das Wohlstandsevangelium muss sich in allen seinen Formen harte Fragen gefallen lassen. Vor allem muss man die Theologie hinter dieser Prämisse ganz massiv hinterfragen. Wie wir Erfolg definieren, wo unsere Identität und Loyalität in Wahrheit liegt, was “Segen” ist und was nicht, welchen Wert Ausdauer, Treue und Resilienz in unserer Theologie haben, die Anzahl aller darin eingebauten “ja, abers”, welche Werte wir mit unserem Geldbeutel bestätigen und welche nicht – viele, viele unbequeme Fragen.
Über die “Gemeinde der Zukunft” nachdenkend, erwachsen aus solchen Gedanken für mich unter anderem zwei Schwerpunkte.
Erstens, eine Lanze für alle brechen, die nicht aufgeben. Dazu gehört, alle Missionare loben, die im Laufe der Missionsgeschichte ihr Leben auf dem Feld gelassen haben, ohne je eine einzige Frucht zu sehen. Jene ermutigen, die sich samt ihren Dienst für Versager halten.
Zweitens, unserer Theologie mal etwas auf den Zahn zu fühlen und fragen, warum sich bei uns ein solch verkapptes Wohlstandsevangelium so penetrant verbreiten konnte. In Zahnlöchern herumpopeln ist schmerzhaft. Doch schmerzhaft kann sehr heilsam sein.
Besser ändert die Gemeinde noch in der Gegenwart den Kurs, bevor sie verzweifelt durch die Windschutzscheibe starrend mit Karacho an die Mauer knallt.